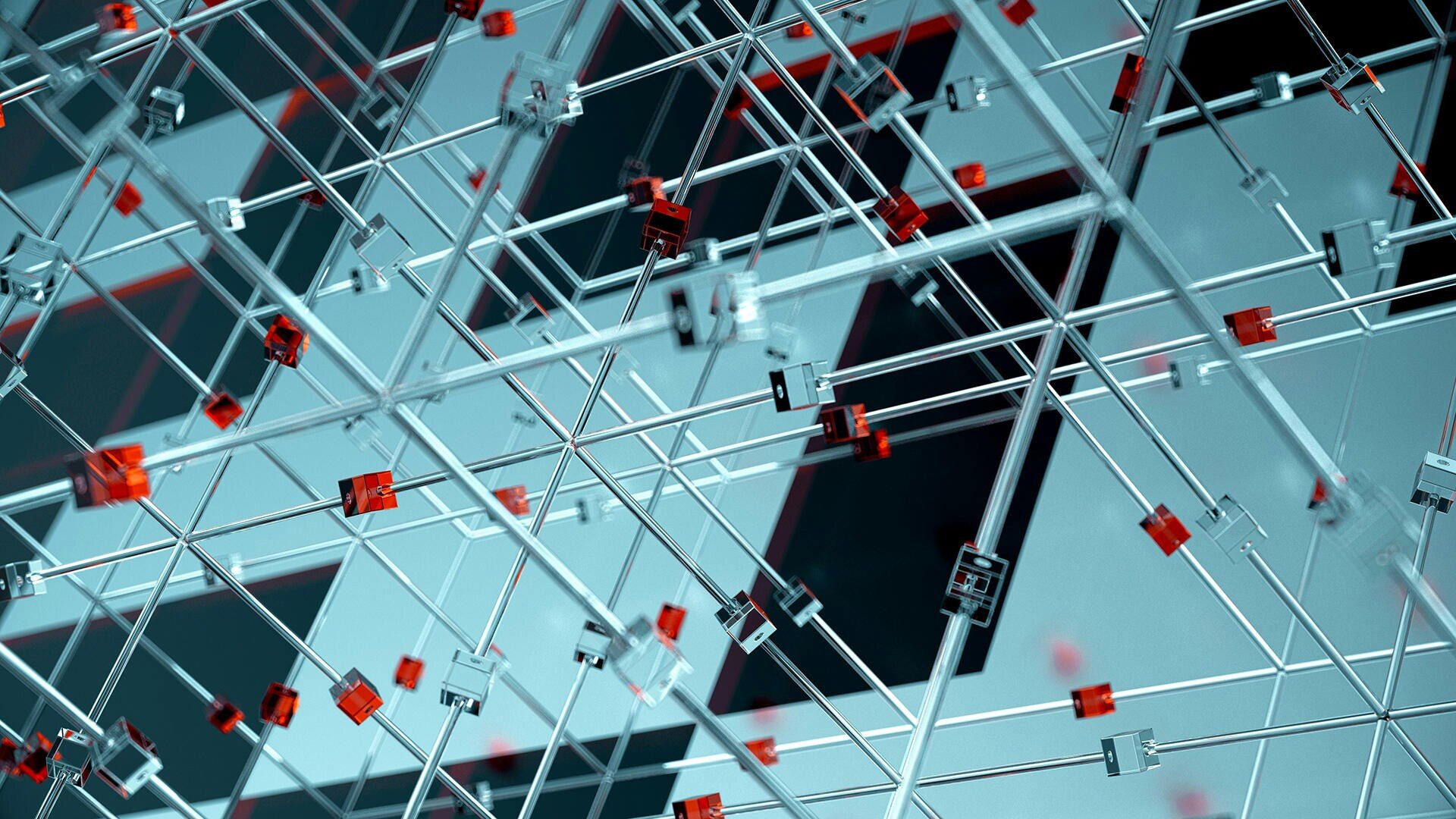Innovation at Pulse Rate – KI als Beschleuniger in der Embedded Entwicklung für MedTech
Wie effizient sind generative-AI-Werkzeuge bei der Entwicklung sicherheitskritischer MedTech-Embedded-Systeme? Eine Studie mit 6 Teams (klassisch und KI-unterstützt) analysierte den Aufwand, die Fehlerrate und die Traceability in Requirements Engineering, Softwareentwicklung und Testfall-Erstellung.
Relevanz
Medizinische Geräte wie Chirurgieroboter, Insulin-Pens oder intelligente Bildgebungssysteme werden zunehmend komplex, während regulatorische Anforderungen (z. B. IEC 62304, ISO 14971 und ISO 13485) immer höhere Hürden setzen. Entwicklerinnen stehen vor der Herausforderung, sowohl Innovationsgeschwindigkeit als auch Compliance in Einklang zu bringen. Genau an dieser Stelle setzen KI-gestützte Werkzeuge an: Sie liefern erste Entwürfe, formulieren testbare Anforderungen und erzeugen strukturierten Quellcode. Die Verantwortung für Architektur, Safety-Cases und regulatorische Freigaben bleibt jedoch klar in der Hand erfahrener Expertinnen.
Studiendesign
Die Studie verglich klassisch arbeitende Teams mit solchen, die auf KI-Tools wie ChatGPT Enterprise, das interne ERNI-LLM "AIDA", GitHub Copilot sowie domänenspezifische Prompt-Bibliotheken zurückgriffen. Alle Artefakte wurden revisionssicher erstellt und anonymisiert ausgewertet.
|
Phase |
KPI (klassisch) |
KPI (mit KI) |
Relative Änderung |
|---|---|---|---|
|
Requirements |
22 Anforderungen / 2 h 58 min |
77 Anforderungen / 1 h 02 min |
−65 % Zeit, +250 % Umfang |
|
Development |
600 LoC, 1 Klasse / 8 h 14 min |
1 000 LoC, 16 Klassen / 3 h 28 min |
−58 % Zeit, +15 % Struktur |
|
Testfall-Design |
12 Tests / 4 h 56 min |
25 Tests / 2 h 30 min |
−49 % Zeit, +108 % Coverage |
Ergebnisse im Detail
Im Requirements Engineering generierten die KI-gestützten Teams aus wenigen Funktionsbeschreibungen eine breite und klar strukturierte Anforderungsbasis mit vollständigen Gherkin-Akzeptanzkriterien. Das manuell arbeitende Team fokussierte sich hingegen auf typische User-Flows und essentielle Anforderungen – eine Strategie, die stärker nutzerzentriert, aber weniger vollständig war. Die KI zeigte hier ihre Stärke durch umfassende Systembetrachtung und klare Struktur, tendierte jedoch gelegentlich zum "Overengineering".
In der Softwareentwicklung führte der Einsatz von KI-Tools zu deutlich schnelleren Ergebnissen. Es entstand in der Hälfte der Zeit ein strukturierter Code mit klarer Modultrennung und Syntax. Die generierten Vorschläge zeigten dabei gute Architekturansätze (z. B. Sensor-Abstraktionen, Dependency Injection), die von den Entwickler*innen weiterverarbeitet wurden. Auch hier war menschliche Nachbearbeitung nötig, um beispielsweise Speicherverbrauch und Echtzeitfähigkeit sicherzustellen.
Besonders deutlich waren die Unterschiede in der Testfall-Erstellung: Die KI deckte nicht nur funktionale Positivfälle ab, sondern ergänzte automatisch auch Negativszenarien, Security-Aspekte und Belastungstests. Jeder Test wurde mit den korrespondierenden Anforderungs-IDs verknüpft, was die Traceability erheblich vereinfachte. Interessant war, dass die KI auch Tests vorschlug, an die die manuelle Gruppe nicht gedacht hatte – etwa bei Ausnahmesituationen oder unerwarteten Benutzerinteraktionen. Während das manuelle Team durch Routine und Erfahrung zielgerichtete, praxisnahe Tests entwickelte, zeigte sich bei längerer Arbeitszeit ein Konzentrationsabfall – ein Effekt, den die KI naturgemäss nicht kennt. Ihre unermüdliche Arbeitsweise kann jedoch auch zur Überproduktion irrelevanter Tests führen.
Diese Gegensätze offenbaren ein zentrales Ergebnis: Während die KI konsistent strukturiert, vollständig und ausdauernd arbeitet, braucht sie Führung. Das menschliche Team wiederum kennt die Domäne, versteht reale Nutzerbedürfnisse und erkennt, wann ein Testfall zwar theoretisch sinnvoll, praktisch aber nicht relevant ist.
Lehren für die Praxis
KI ist kein Ersatz für menschliches Engineering, sondern ein leistungsfähiger Partner. Ihre Stärken entfaltet sie besonders in der systematischen Strukturierung, schnellen Generierung und Ermüdungsresistenz. Menschliche Expertise bleibt jedoch unersetzlich, um Relevanz zu bewerten, Risiken zu erkennen und regulatorische Anforderungen zu interpretieren.
Besonders wertvoll kann sich KI als Pair Programmer und Assistent erweisen: Junior-Ingenieurinnen können durch KI-Vorschläge schneller lernen und strukturiertes Arbeiten übernehmen. Senior-Expertinnen könnten dadurch ihren Fokus stärker auf Architektur, Risikoanalyse und Review verlagern. Gleichzeitig zeigte sich: Automatisch erzeugte Artefakte benötigen fundierte Reviews, um zulassungsfähig zu sein. Prompt-Engineering entwickelt sich dabei zur neuen Schluesselkompetenz.
Wichtigste Erkenntnisse in Kürze
- KI verkürzt die Bearbeitungszeit um bis zu 60 % und steigert die Testabdeckung um mehr als das Doppelte.
- Vollständige Trace-Chains reduzieren den Pflegeaufwand signifikant.
- Reviews bleiben Pflicht, heben aber die Gesamt-Velocity, wenn sie früh und engmaschig eingeplant werden.